
Feldpost ❘ Die Arbeit der Feldpost ❘ Zensur ❘
Literatur ❘ Werkstatt ❘ Ausgewählte Briefe ❘ Links ❘
Sammlungen und Archive ❘ Briefe an ein Archiv übergeben ❘ Tipps zum Aufbewahren ❘
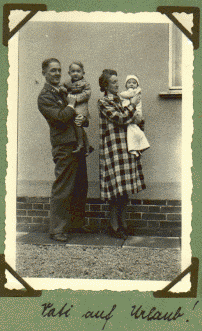
Treffender als Ulla es Jahrzehnte danach ausdrückt, kann man das Erleben der briefwechselnden Kinder und ihrer Väter in der Kriegszeit nicht beschreiben. "Dann mach ich immer als ob Du da sitzt", schreibt Edith an ihren Vater, und Giselas Vater schreibt: "Vatel saß beim Lesen Deines lieben Briefleins gleich neben Dir in unserer Küche [...] Ich hörte die Hühner gackern und das Schaf blöken..." - eine kleine Weile ist Giselas Vater heimgekehrt an den Platz, der auf ihn wartet. Zugleich ist die Leere, die durch Abschied, Getrenntsein und räumliche Ferne auch bei ihm entstanden ist, erfüllt von der Gegenwart seiner Lieben. Als Unterpfand hält er den Brief in der Hand, der auf dem vertrauten Tisch gelegen hat, dort berührt, beschrieben und ausgeschmückt wurde.
Mit den lebendigen, detailreichen Schilderungen aus dem häuslichen Alltag und der erwartungsvollen Zuwendung in den Briefen ihrer Kinder erreicht die Väter Leben pur. Zukunftsvisionen steigen auf: "Und dann, wenn wir drei wieder glücklich vereint sind, werden wir abends beieinander sitzen..." (Giselas Vater, 10.6.1944); Träume vom Leben nach dem Krieg: "Wenn der Krieg alle ist, gehen wir zusammen ins Theater" (Theas Vater, 1.1.1942); aber es entwickeln sich auch Phantasien, welche die reale Heimkehr später erschweren konnten, weil die Wirklichkeit sich während der langen Trennungszeit geändert hatte.
Wille und Zwang wurden herausgefordert, sich nicht aufzugeben, um zu überleben für die Heimkehr und um der Verantwortung willen, dem Leben - den Kindern - seine Chance zu erhalten. Nicht anders sind die Vaterbriefe zu verstehen in ihrem Bemühen um die Erziehung und das Fortkommen der Kinder, in ihrer Sorge, dass diese das Leben bestünden. Mahnungen und Zurechtweisungen, Erwartungen, Orientierungshilfen, Wertvorstellungen - eine Hilfe zur Lebensbewältigung, um die uns heute mancher Jugendliche beneiden dürfte -, haben, schriftlich niedergelegt, eine nachhaltige Wirkung, was viele "Gestrige" im Laufe des späteren Lebens mit Dankbarkeit feststellten.
Ganz besonders gilt dies, wenn Briefe ein letztes greifbares Vermächtnis eines im Krieg verlorenen Vaters sind. "Mein guter Junge! [...] Mit dem neuen Jahr kommt für Dich vielleicht auch manch entscheidungsvoller Augenblick. Zunächst aber denke daran. Dein schulisches Wissen, soweit noch die Möglichkeit besteht, zu erhöhen. [...] Bleibe weiterhin gesund an Körper und Seele und pflichttreu Dir selbst gegenüber. So brauchst Du Dir nie Vorwürfe zu machen. [...] Es hat Dich lieb Dein Vater" (Detlefs Vater am 30.12.1944, gefallen im Frühjahr 1945).
Unter der mosaikartigen Oberfläche der Kinderbriefe, auf den ersten Blick eine Ansammlung einzelner Mitteilungen aus dem Alltagsgeschehen, verbirgt sich eine andere Motivation zum Briefeschreiben als lediglich einer Pflicht nachzukommen.
Die Väter fehlten ja nicht nur physisch, sondern ebenso im Bereich der Gefühle. "So ein Vater ist etwas Beruhigendes", erinnert sich eine Zeitzeugin an den Vater, als der während eines Bombenangriffs auf Urlaub war, und damit an die andere Seite von Autorität. Den äußeren Entzug aufzufangen, ist wie für die Väter so auch für die Kinder, die jüngeren und die älteren gleichermaßen, das eigentliche Anliegen der Briefwechsel, die körperliche Abwesenheit je nach Bedürftigkeit, Fähigkeit und Bemühen in um so konzentriertere Anwesenheit verwandelnd.
"Schon wieder denkt an dich dein Richard." (12.2.1943) Und: "In Gedanken bin ich immer bei Euch, wo immer ich auch bin", schreibt Christines Vater (gefallen 1943). Nicht nur durch seine Briefe und Geschenke, die er schickt, erscheint der Vater greifbar. Im eigenen Schreiben vergewissert sich das Kind seiner Existenz, indem es ihn anspricht, ihn an seinem Leben teilnehmen lässt: "mein li ber pappa ich bin gra de mit schul la fer tich und mus dir noch gu ten nacht sä gen" (Ulla, 6 Jahre, 1944).- "Ich sitze hier im Kinderzimmer am Tisch, unten an der Ecke wo der Ofen steht und habe Lottchen dicht zu mir geschoben und dann schreibe ich" (Ingeborg, 23.5.1943). Der Vater wird um Erlaubnis und Rat gefragt: "Du hattest uns gesagt, daß wir Dir erst schreiben sollten, bevor wir Mami etwas kaufen wollten [...] Was meinst Du, sind die Tortenschüsseln nicht ein bißchen teuer?" (Trudel, 15.12.1942 an den Vater in Russland) Und Liese fragt: "Lieber Vati, ich weiß mal wieder nicht was und wie. Wir bekamen heute ein Aufsatzthema [...] Würdest Du mir bitte einen kleinen Fingerzeig geben? (Die anderen fragen auch alle ihre Väter.)" (12.2.1942) Wünsche und Sorgen werden an den Vater herangetragen: "Ich muß jeden Tag mit Turnschuhen zur Schule gehen. Mutti will es nicht erlauben, daß ich die Holzsandalen anziehe, schreibe Du ihr doch einmal, daß sie es mir erlauben soll" (Marion, 8.5.1942). Indem es dem Vater in Gedanken folgt und diese Vorstellung schriftlich fixiert: "... habe ich auch die zwei Bleistifte bekommen [...] Vielleicht kannst Du sie selber gebrauchen, oder Du gibst sie dem Russen, der mit den Bleistiften malen kann" (Ingeborg, 11.3.1944), stellt das Kind die Gewissheit her, dass der erwünschte Vater erreichbar ist. Im Schreiben holt es seinen Vater zu sich heran, holt ihn heim. Aus "Er war fort und doch nicht fort" macht das Kind: "Er ist nicht da, aber doch da".
Vieles, was heute nicht viel anders ist und vor allem jüngere Kinder oft nicht verbalisieren können, obwohl das Erleben z.B. einer Trennung sicher ähnlich ist wie damals, wird durch die von den Umständen erzwungene Verschriftlichung in den Feldpostbriefen deutlich: Kinder möchten, dass ihre eigenste Welt heil ist. Ein Vater fehlt ja nicht nur bei den Mahlzeiten. Wir Kinder damals bedauerten die Unvollständigkeit der Familie, aber wir fügten uns ihr nicht. So entstanden diese Briefe auch in dem Bemühen und als Mittel, die Ganzheit der Familie so gut wie möglich zu bewirken und zu erhalten. "Ich freue mich schon, wenn du auf Urlaub kommst. Weil Du so lange nicht bei uns warst! Und es ist auch garnicht schön ohne Vater, es ist viel schöner wenn die ganze Familie zusammen ist" (Richard, 13.1.1944).
Die Briefe dieses einzigen zusammenhängenden Quellenbestandes seiner Art wurden nicht - wie z.B. Aufzeichnungen professioneller Autoren - mit dem Blick auf ein späteres öffentliches Interesse verfasst. Von Seiten der Briefautoren ist die Publikation in erster Linie gedacht als persönliche Begegnung mit den hinter den Briefen aufscheinenden Menschen. Den Menschen zuhören und in ihrem täglichen Leben zuschauen sollte im Zentrum des Leserinteresses stehen. Was in den Wohnstuben geschah, was Menschen erlebten, taten, fühlten, dachten, möchten Enkel wissen, Geschichten aus dem Leben, nicht wirklichkeitsferne Theorien über abstrakte, zu Klischees verunstaltete "Typen", wie sie nicht nur in unserem Fall Pauschalurteilen ausgeliefert werden. Geschrieben aus dem erlebten Augenblick, verschafft jeder der Briefe für sich als unmittelbar einzusehende Quelle ein differenziertes Bild von einzigartigen, lebendigen Menschen. Nur auf diese Weise ist er einzuordnen, in seinem Eigen-Sinn unabhängig vom jeweiligen Stand der Wissenschaft und vom Blick durch die Sicht verzerrende Denkraster. Briefe sind Dokumente. Sie liefern Fakten und entziehen sich einebnendem Schubladendenken - wie es auch an den vielen nicht in dieses Projekt einbezogenen Briefen meiner Sammlung vor allem von Vätern an ihre Kinder deutlich wird.
Politische und private Geschichte sind selten - oder nie? -deckungsgleich. Die Briefwechsel zwischen Kindern und ihren Vätern in den Kriegsjahren sind nicht auf Politik als Thema ausgerichtet, sondern - auch da, wo sie Aussagen zum Weltgeschehen versuchen - darauf, die Beziehung zwischen Kind und Vater gegen alle Widrigkeiten aufrechtzuerhalten unter Umständen, durch die auf diese Art der Kommunikation zurückgegriffen werden musste und die sie förderten (übrigens auch die dazu nötigen technischen Fähigkeiten), wobei sich oftmals ein ungewöhnlich intensives vertrauensvolles "Briefgespräch" - so nennen bezeichnenderweise manche heute ihre Briefwechsel - entwickelte.
Nicht wir. Wir waren nicht vaterlos. Selbst wenn ein Vater gefallen oder vermisst ist, war er präsent, oft erst recht, denn sein Andenken wurde in Ehren gehalten bis heute.
Da die auf Vertrauen und Zärtlichkeit beruhende Autorität der Väter ungebrochen war, hatte die herrschende Ideologie des Nationalsozialismus bei weitem nicht den von ihren Trägern erstrebten, für junge Menschen wie zu jeder Zeit schwer zu durchschauenden und nachhaltigen Einfluss, wie er dem heutigen abstrahierenden Denken von Nichtzeitzeugen plausibel erscheint. "Habt ihr denn alle zusammen den Verstand verloren, kaum nachdem Ihr das Elternhaus verlassen habt?" (Egberts Vater, 9.2.1944) Du bist "noch so unreif, auf jeden Propagandaquark hereinzufallen" (9.4.1944). "Ich weiß aus allereigenster Erfahrung, wie leicht man als junger Mensch den Kopf verdreht bekommt und wie gewissenlos jeder jugendliche Idealismus [...] mißbraucht wird" (26.6.1944).
Vaterlos sind, die an ihre Eltern und Voreltern nur (verurteilend denken können, sich aber am Grunde ihres Seins nach Verständigung und befreiender heilsamer Heimkehr sehnen.
So schicken wir denn diese Briefe auf den Weg, im Vertrauen auf die ihnen innewohnende Botschaft von der Trotzmacht des Lebens, der Hoffnung und des Miteinanders.
* Mit freundlicher Genehmigung der Autorin. Der Aufsatz ist unter dem Titel: "Wir sind nicht vaterlos - Nachwort einer Sammlerin" erschienen in: Burkhard, Benedikt und Friederike Valet (Hrsg.): Abends wenn wir essen, fehlt uns immer einer. Kinder schreiben an die Väter 1939-1945. Auf der Grundlage der Sammlung von Herta Lange, Heidelberg 2000