
Feldpost ❘ Die Arbeit der Feldpost ❘ Zensur ❘
Literatur ❘ Werkstatt ❘ Ausgewählte Briefe ❘ Links ❘
Sammlungen und Archive ❘ Briefe an ein Archiv übergeben ❘ Tipps zum Aufbewahren ❘

Foto von der Buchpräsentation (v.l.n.r.): Wolfgang Weist (Verleger, Trafo Verlag) Thomas Jander und Jens Ebert (Heruasgeber)
Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wird sich dieses Jahr zum siebzigsten Mal jähren. Die Spuren, die er in den Städten und auf dem Land hinterlassen hat, sind fast völlig beseitigt. Die Erinnerung an ihn scheint verbannt in die Vitrinen der Museen und Ausstellungen, in Film- und Fernsehproduktionen.
Doch auch die Menschen, die den Krieg erlebt haben, die sich an ihn erinnern und ihre ganz persönliche Geschichte aus der Zeit des Krieges erzählen können, werden immer weniger. Mit dem Verschwinden der Zeitzeugen aber wird das Interesse an den historischen Ereignissen, Wahrnehmungen und Zusammenhängen nicht nachlassen. Zumindest in Bezug auf die Vielfalt von Wahrnehmungen und deren sprachlicher Umsetzung in ihrer Zeitgebundenheit, sind Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg eine nicht gering zu schätzende Quelle.
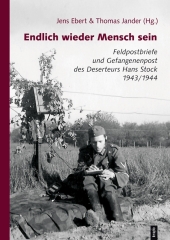
Nun ist die Reihe von veröffentlichten Kriegsbriefen aus der Zeit zwischen 1939 und 1945 mittlerweile bemerkenswert lang. Und daher ist die Frage, warum hierzu noch ein weiterer Band hinzugefügt werden soll, nicht völlig unberechtigt.
Es sind verschiedene Gründe und der wesentlichste scheint mir der offensichtlichste zu sein: Es handelt sich um Briefe eines Deserteurs. Es mögen viele Briefe von Soldaten geschrieben worden sein, die später desertierten, ohne je darüber ein Wort verloren zu haben. Doch Stocks Fahnenflucht wirft in seinen Briefen bereits lange Schatten voraus, und das nicht nur zwischen den Zeilen. Offen ergreift er das Wort, um seine Unzufriedenheiten zu thematisieren und mitzuteilen. Es sind darunter nicht nur die üblichen éMeckereien' der Soldaten über dumpfen Dienst, schlechtes Essen, zu wenig Urlaub und dergleichen mehr. Auch wenn ihn solche Dinge selbstverständlich ebenso verärgerten und er die Abwesenheit von Bequemlichkeiten immer wieder monierte, saß Stocks Opposition weitaus tiefer: er hasste das Soldatendasein.
Jenseits der großen Erzählungen, bleiben die Geschichten des sprichwörtlichen "einfachen Soldaten" noch oft genug im Verborgenen. Und gerade wer nicht angepasst war an das militärische Leben, wer nicht hart genug war, die Verbrechen des Krieges zu ignorieren, seine Schrecken stur hinzunehmen und bis zum bitteren Ende weiter zu marschieren, der hinterließ meist keine Spuren im Sand der Geschichte.
Für Überläufer und Deserteure gilt diese Feststellung um so mehr. Ein paar Gerichtsakten, juristische Gutachten oder Erschießungsbefehle sind meist die einzigen Zeitzeugnisse ihrer höchst tragischen Schicksale. Hier nun liegen Texte vor, die eine Fahnenflucht und deren Motivationen bis zum Ereignis selbst mitverfolgen lassen.
Soweit mir bekannt ist, gibt es bislang keine Veröffentlichung von Dokumenten dieser Art.
Hans Stock war 1933 elf Jahre alt, und eine kurze Zeit lang mochten womöglich auch ihm die Geländespiele des Jungvolks und später der Hitlerjugend einen gewissen Spaß bereitet haben. Doch das uniforme und antiindividuelle Ideal der jungen Braunhemden wurde ihm bald zuwider und das militärisch stumpfe Exerzieren übte erst recht keinen Reiz auf ihn aus. So zeigen die Briefe einen unangepassten jungen Menschen, der den Krieg nicht nur einfach überleben wollte. Sondern sie zeugen auch von den Handlungsspielräumen, die es ihm als Soldat möglich machten, sich einem Krieg zu entziehen, dessen verbrecherischen Charakter er nur zu bald erkannt hatte. Ohne eine offensichtliche politische Grundierung, handelte Stock schon dadurch politisch, dass er desertierte, weil er nicht nur sein Leben retten, sondern auch, weil er es keinem anderen Menschen nehmen wollte.
Ein weiterer Grund, warum wir diesen Briefwechsel veröffentlichen, ist, dass er zum Teil von erschreckender Offenheit ist. Anders als die meisten Soldaten, ist Stock in seinen Briefen auf eine wenig soldatische Weise hemmungslos bei der Widergabe der eigenen Gefühls- und der Beschreibung seiner oft grauenhaften Umwelt.
Dies hängt nicht zuletzt mit dem für die damalige Zeit ungewöhnlich offenen Verhältnis zu seiner Familie zusammen, besonders zu seiner Mutter. Obwohl es auch in dieser Familie mit Sicherheit Schweigemauern gab: was den Krieg betraf, existierten sie kaum. Trotz der Gefahr, durch die Zensurbehörden entdeckt zu werden, sind die Briefschreiber zum Teil gefährlich redselig. Das gilt besonders für Hans, denn obwohl sich auch seine Mutter bisweilen wenig in Zurückhaltung übte, warnte sie ihren Sohn oft und nachdrücklich vor der Gefahr "falscher" Worte, die ihn womöglich den Kopf kosten könnten.
Damit wäre auch schon der dritte Punkt angesprochen, der diesen Briefwechsel zu etwas Besonderem macht - die Sprache. Mit oft erfrischend bissiger Ironie bzw. mit harten und treffenden Worten erzählt Stock von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Dort wo viele Soldaten sich in gängige und wiederholende Formeln flüchten, weil sie es schlicht nicht gewohnt waren, den Angehörigen ausschließlich auf dem Schriftweg etwas mitzuteilen bzw. weil sie für das, was sie erlebten keine anderen Worte fanden, als die, die ihnen Vorlagen der Wehrmachtspropaganda in die Feder diktierte, beschreibt Stock das Geschehen oft sehr eindringlich, ausführlich und auf dichte Weise.
Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass er sein Soldatenleben regelrecht dokumentierte und es verfestigt sich mit forschreitender Lektüre der Eindruck, dass ihm nicht daran gelegen war, seinen Eltern allzu viel zu ersparen.
Schließlich, und eben ist es schon ein wenig angeklungen, sind die Briefe Hans Stocks und seiner Eltern im wahrsten Sinne inhaltsreich. Im Gegensatz zu den allermeisten Feldpostbriefen findet der Krieg in ihnen tatsächlich statt. Es gibt keine Fluchten ins Banale und Alltägliche aus Scham, Unvermögen oder Verdrängung gegenüber dem Erlebtem. Nicht nur die Sprache, sondern auch die durch sie vermittelten Inhalte heben diesen Briefwechsel bemerkbar von anderen ab.
Stocks Soldatenleben begann bei Berlin. Im April 1941 erreicht ihn der Einberufungsbefehl. Stock ist grade 19 Jahre alt, als er zum ersten Mal den Stahlhelm aufsetzen soll. Doch hat er noch Glück im Unglück. Erst Schönwalde im Brandenburgischen, dann Gatow: das ist nicht weit entfernt von zu Hause, die meisten anderen Soldaten traf es oft viel härter. Und es kam noch besser: Die Hauptfilmstelle der Reichsluftwaffe, eine von Hermann Göring geschaffene Einrichtung zur Herstellung von Lehr- und Propagandafilmen, wurde für etwas mehr als ein Jahr die Dienststelle Stocks. Doch dieses halbzivile Dasein in Berlin-Lankwitz, wo Stock statt zu Schießen und zu Exerzieren, als Kameraassistent Filme drehte, geriet in Gefahr, als der Krieg für das Deutsche Reich immer mehr Verluste forderte.
Anfang 1943, die 6. Armee wurde gerade bei Stalingrad vernichtet, war es dann endgültig vorbei.
Hans Stock wird zum Infanteristen und erlebt nun die Härten und Schikanen des Drills beim Heer. In Belgien wird die 44. Infanterie-Division, zu der Stock schließlich kommandiert wird, aus ihren Überresten neu aufgestellt. Aufgefüllt wurde die im Kessel von Stalingrad zerschmolzene Division mit neuem Menschenmaterial und Stock war einer von den Tausenden Soldaten, die in bisher kampffernen Einrichtungen ihren Dienst versahen und nun die raue Luft der Front atmen sollten. Da wurden selbst alte Gefreite wieder zu Rekruten und rund um die Uhr "geschliffen". Er schreibt in März:
Stock versuchte bereits in Belgien, sich dem militärischen Alltagswahnsinn so gut es ging zu entziehen und es gelang ihm ganz leidlich. Er wird bald Postholer seiner Kompanie und verbringt fortan zumindest eine gewisse Zeit in den Freiräumen, die er sich dadurch schaffen konnte. Seine Sehnsucht nach Selbstbestimmung wird dadurch aber nicht befriedigt: im Gegenteil - sie steigt noch an. Und selbst in Situationen, in denen auch er mit allen anderen mitmarschieren musste, suchte er sich seine Nischen:
an anderer Stelle heißt es:
Doch die Zeit in Belgien diente nur zur Vorbereitung der Division für einen erneuten Weg zur Front. Der erste Einsatz des Verbandes führte Stock im Spätsommer nach Italien.
Der Bundesgenosse hatte dem Reich gerade die Gefolgschaft aufgekündigt und die deutsche Wehrmacht übernahm auf der Appeninhalbinsel die Macht. Vor Stocks neidischen Augen warfen lachende italienische Soldaten ihre Waffen weg - für sie war der Krieg aus, für Stock noch nicht. Er musste weiterziehen, denn Rommel, sein Oberbefehlshaber, hatte die Anweisung bekommen, die Partisanen an der Grenze zu Slowenien zu vernichten.
Partisanenbekämpfung war eine besondere Art von Krieg. Durch solche Einsätze wurden die jungen Soldaten auf eine perfide Weise "sozialisiert". Zum einen konnten sie das Töten lernen, ohne in allzu große Gefahr zu geraten, selbst getötet zu werden. Zum anderen stärkten solche Einsätze den "Kameradschaftsgeist", schweißten zusammen und hoben nicht zuletzt die Moral, denn die heimgesuchten Dörfer waren Kriegsbeute und wurden regelmäßig geplündert. Stocks Briefe aus dem Partisanenkrieg beschreiben deutsche Kriegsverbrechen in einer sehr seltenen Deutlichkeit und mit einer brutalen Bildersprache, die nichts zu beschönigen oder auszulassen scheint.
Bei einem dieser Einsätze erlebte Stock selbst aber seinen, wie er es in einem Brief nannte, ersten "Stosstrupp in die Freiheit". Er wurde von seiner Truppe abgesprengt und war mehrere Tage allein unterwegs. Zurück kehrte er wohl nur deshalb, da es hier für ihn schlicht keinen Ort gab, wo er den Krieg ihn Sicherheit überleben konnte.
Kurz darauf, im Spätherbst 1943, nachdem die Partisanenjagd abgeblasen wurde, verlegte das OKW Stocks Division, die für die Zeit der Bandenbekämpfung - so die offizielle Sprachregelung - der SS unterstellt war, nach Süditalien. Dort waren seit zwei Monaten die alliierten Streitkräfte auf dem Vormarsch. Der sollte aufgehalten und zurückgeworfen werden.
Die deutschen Soldaten kamen im Schneetreiben an und hatten sich in Erdbunker einzugraben. Zu ihren Häuptern thronte das alte Benediktinerkloster auf dem Monte Cassino. Die Gegend war ebenso gut zu verteidigen, wie schwierig zu erobern, und die Briten und Amerikaner taten sich schwer damit, Boden zu gewinnen. Doch ihre materielle Überlegenheit gab schließlich den Ausschlag zu ihren Gunsten. Stock hatte das Inferno der Schlacht zwei Wochen lang überlebt, als er schließlich den seit einiger Zeit gereiften Entschluss umsetzte. Er desertierte. Zuvor schreibt er seiner Mutter aus seinem Erdbunker:
Es sind vor allem die Briefe aus diesen letzten Tagen im Januar und Februar 1944, die zeigen, dass Stocks Fluchtgedanken auch den Eltern nicht unbekannt waren. Am Ende forderte die Mutter den Sohn regelrecht auf, zu fliehen. Auf den oben zitierten Brief antwortet sie:
Die letzten Zeilen hat Hans Stock nicht mehr zu lesen bekommen. Er war bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, wo er hinter Stacheldrahtzäunen die Freiheit wiederfand.
Für die Eltern setzte nun eine qualvolle Zeit der Ungewissheit ein. Bald kam die Meldung, Hans sei vermisst. Es dauerte noch bis zu jenem Tag, als in der Wolfschanze die Bombe detonierte, mit der bis die Eltern, die Nachricht erhielten, dass ihr Sohn in Sicherheit und am Leben war. 1946 kehre Hans Stock nach Berlin zurück.
Zur Erinnerung an den Krieg gehört auch diese - ermutigende - Erinnerung an die Soldaten, die "Nein" sagten zum Weitermarschieren, zum Brandschatzen und zum Töten oder Getötetwerden. Ermutigend ist diese Erinnerung schon allein deswegen, weil sie hervorholt, dass es das "andere Deutschland", von dem die Verschwörer des 20. Juli 1944 der Welt ein Zeichen geben wollten, existiert hat. Denn ganz gleich aus welchen Beweggründen ein Soldat seinen "Haufen" verließ, es war eine mutige und individuelle Entscheidung.
Bereits im März 1943, nur wenige Wochen nach dem Beginn der Ausbildungszeit beim Heer schreibt Stock verzweifelt an seine Mutter:
Ein einfacher, leicht pathetischer Satz vielleicht, aber er drückt auf den Punkt genau aus, was Stock wollte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.